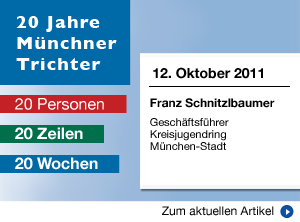
Was unterscheidet den Münchner Trichter vom Nürnberger Trichter?
Aus altbayerischer Sicht natürlich zunächst einmal der sprachliche Aspekt – in München sagt man nicht „Loddar“ und man „leided“ auch nicht.
Der Münchner Trichter ist aber vor allem frei von der Vorstellung, dass man jungen Menschen Wissen „eintrichtern“ könnte, wie dies ja der Nürnberger Trichter seit dem 17. Jahrhundert suggeriert. Die Vorstellung, dass sich Schüler/innen mit der so bezeichneten Form der Didaktik Lerninhalte fast ohne Aufwand und Anstrengung aneignen können und ein Lehrer andererseits den Objekten seiner Bemühungen alles beibringen könnte, ist dem Münchner Trichter völlig fremd.
Der Münchner Trichter zeichnet sich vielmehr durch eine fast schon übertriebene Betonung des Subjektiven aus. Das Subjekt wird beim Münchner Trichter nicht nur bei den pädagogischen und sozialpolitischen Bemühungen um (junge) Menschen konsequent in den Mittelpunkt gestellt, sonder auch beim internen Organisationsaufbau. Die Funktion des Trichters besteht hier vor allem darin, die höchst unterschiedlichen Charaktere der Protagonisten zusammenzuführen und eine stringente Linie des Handelns zu ermöglichen. Als Außenstehender kann ich nur ahnen, dass diese Funktion nicht immer mechanisch, sozusagen mittels der Schwerkraft zu erfüllen war. Vermutlich bedurfte es prozesshafter Bemühungen aller Beteiligten, die dem Münchner Trichter in den 20 Jahren seines Bestehens aber immer wieder sehr gut gelungen sind.
Herzlichen Glückwunsch dazu und vielen Dank für die wertvolle jugend- und sozialpolitische Arbeit des Münchner Trichters im Namen des Kreisjugendring München-Stadt!
Bleibt die Erkenntnis, dass man den Münchner Trichter zwar sehr gut „leiden“ aber sicher nicht leiten kann und dass Lothar sagen würde: „Again what learned!“

